
Was gibt’s Neues?
Wann, wenn nicht jetzt? Vorschläge zur Beschleunigung der Energiewende mit „Energieberatung 2.0“
Seit Einführung der Energieeinsparverordnung im Jahre 2002 haben wir – Kati Jagnow und Dieter Wolff – in fast jährlichem Abstand Vorschläge veröffentlicht, wie das Energiesparrecht durch reale Verbrauchsauswertung anstelle theoretischer Bedarfsrechnungen drastisch vereinfacht werden könnte. Seit 2020 haben wir dies mit einem Tool „Standardbilanz“ weiterentwickelt. Wir hoffen, dass unsere Ergebnisse weitere Verbreitung finden, um viele zu überzeugen:
- wie unsere EXCEL-Tools Standardbilanz, Energieanalyse aus dem Verbrauch und Optimierung von Heizanlagen zur Beschleunigung der Energiewende beitragen können,
- wie eine Zusammenführung von Gebäudeenergiegesetz (GEG), Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und Wärmeplanungsgesetz (WPG) bis 2026 mit einem geschätzt um den Faktor 10 verringerten Kosten- und Zeitaufwand erfolgen könnte. [
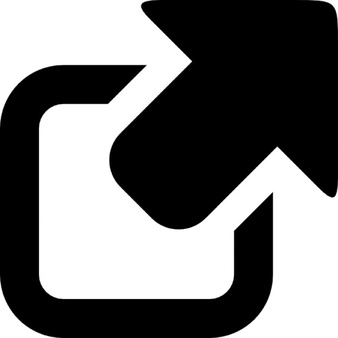 externer LINK zum TGA Fachplaner]
externer LINK zum TGA Fachplaner]
Die nachfolgend vorgestellten Videos liefern detailliert die für das Verständnis notwendigen Hintergrundinformationen v.a. für Energieberater und damit für eine möglichst schnelle Transformation in Richtung Klimaneutralität, v.a. mit Wärmepumpen als No-Regret-Maßnahme.
- Standardbilanz [
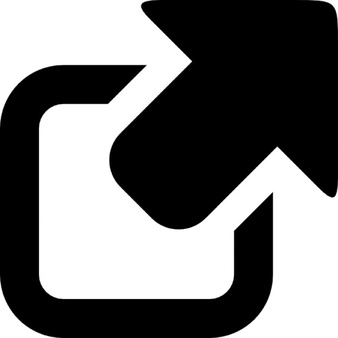 externer LINK zur Playlist] [Download Programm]
externer LINK zur Playlist] [Download Programm] - Energieanalyse [
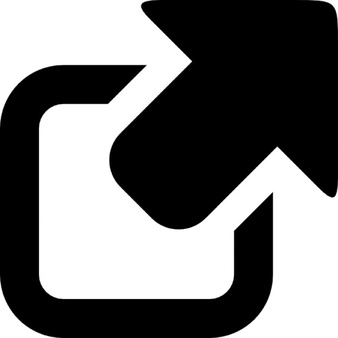 externer LINK zur Playlist] [Download Programm]
externer LINK zur Playlist] [Download Programm] - Optimus [
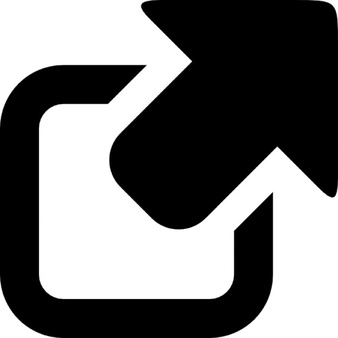 externer LINK zur Playlist] [Download Programm]
externer LINK zur Playlist] [Download Programm]
Vorschläge zur Wärmepumpenplanung und zur Heizlastermittlung
Grundsätzliche Vorschläge für Neu- und Bestandsanlagen
Der Einsatz getrennter dezentraler Wärmepumpen nur für Raumheizung und nur für Trinkwarmwasser zusammen mit PV und Batteriespeicher ergibt nach unseren Studien und Gutachten für den Deutschen Bundestag sowie für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt DBU mit dem für mikro- und makrowirtschaftliche Untersuchungen entwickeltem EXCEL-Tool „Standardbilanz“ sowohl für Ein- als auch für Mehrfamilienhäuser viele Vorteile gegenüber einer zentralen Wärmepumpe mit komplexer Verteilung, Speicherung, Regelung und Hydraulik.
Aus Investitionskostengründen und wegen ihres größten Marktanteils werden hier nur monoenergetisch und bivalent-parallel mit elektrischem Heizstab betriebene und modulierend geregelte Heizwärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel Propan für Heizleistungen bis maximal 30 kW behandelt.
Heizkörperheizungen im Bestand sind in der Regel dafür geeignet. Durch Austausch einzelner Heizkörper im Rahmen einer Optimierung mit hydraulischem Abgleich und vereinfachter Raumheizlastermittlung nach VdZ-Verfahren B (EXCEL-Tool: OPTIMUS) sollten Auslegungsvorlauftemperaturen von 45°C bis max. 60°C angestrebt werden.
Nur noch in Ausnahmefällen sollte in Bestandsgebäuden ein noch funktionierender Öl- oder Gaskessel bivalent-alternativ mit einer neuen Heizwärmepumpe geplant werden. Eine rein manuelle Umschaltung bei niedrigen Außentemperaturen auf den fossilen Spitzenlastkessel durch den Betreiber ist hierbei die kostengünstigste Lösung.
Gleiche Vorschläge gelten auch für vorhandene solarthermische Anlagen zur Trinkwarmwasserbereitung oder sogar zur Heizungsunterstützung. Verschiedene Regler und komplexe Hydraulikschaltungen müssen dann nicht mit hohem Kostenaufwand aufeinander abgestimmt werden.
Durch Verbesserungen einzelner Bauteile der Gebäudehülle (Fenster, ungedämmte Außenwände, Keller- und oberste Geschossdecken) und schnellst möglichen Einbau von PV und Batteriespeicher als Ersatz für vorhandene Solarthermie sollte mittelfristig ein monoenergetisch elektrischer Betrieb der Heizwärmepumpe mit elektrischem Heizstab angestrebt werden (Planung auf Vorrat). Der Einbau einer neuen komplexen Hybridanlage aus Wärmepumpe mit neuen Gas- oder Ölkesseln bzw. mit Holz oder sogar mit Solarthermie wird wegen zu hoher Investitionskosten nicht empfohlen.
Mit unseren Vorschlägen sollen zukünftig wirtschaftliche Rahmenbedingungen für den Einbau von Wärmepumpen, PV und Batteriespeichen bereits bei aktuellen Energiepreisen für Gas und Strom unter dem Gesichtspunkt optimierter Gesamtkosten aus Kapital, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten gewährleistet werden.
Vorschläge zu notwendigen Herstellerdaten und zur Heizlastermittlung
Von den Herstellern sind zukünftig zur Planungs-, Auslegungs- und Betriebsoptimierung Leistungsdaten für Wärme und Strom für den gesamten Modulationsbereich (in 10%-Schritten bezogen auf die elektrische Kompressorleistung) zwischen max. und min. Heizleistung in Abhängigkeit von Außen- und Vorlauftemperatur (mindestens jeweils in 5K-Schritten) zu fordern.
Die Heizlast bzw. der Wärmeverlustkoeffizient H in W/K sollte bevorzugt mit dem Werkzeug „Energieanalyse aus dem Verbrauch“ EAV aus unterjährigen Verbrauchsmessungen ermittelt werden.
Bei Jahresverbrauchswerten für Fernwärme, Gas und Öl (z.B. aus MFH-Energieverbrauchsausweisen) sollten diese witterungsbereinigt und unter Berücksichtigung der Kesselverluste mit dem EXCEL-Tool „Standardbilanz“ abgeglichen werden.
Eine theoretische Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 liefert nach eigenen umfangreichen Auswertungen in der Regel etwa 30 (neue Gebäude) bis zu 50% (ältere Bestandsgebäude) höhere Werte für den Wärmeverlustkoeffizienten H in W/K gegenüber Auswertungen mit dem EAV-Verbrauchsverfahren, das ebenfalls in die DIN/TS 12831-1 (2020) als nationale Ergänzung aufgenommen wurde. Generell sollte für die WP-Auslegung nicht die „Brutto-Normheizlast“ nach DIN EN 12831, sondern die „Nettoheizlast“ unter Berücksichtigung einer typischen Heizgrenz-temperatur von 15°C angesetzt werden. Hierdurch ergeben sich zusätzliche Vorteile für eine angepasst und nicht zu groß dimensionierte Heizwärmepumpe von 20% als Unterschied zwischen Brutto- und Nettoheizlast.
Die nach VDI 4545 empfohlenen Heizgrenztemperaturen von 10°C bis 15°C für unterschiedliche Gebäudestandards sind hierbei aus unserer Sicht nicht praxisgerecht. Eine Überdimensionierung kann hierdurch verhindert werden. Der Bivalenzpunkt sollte dann, je nach Gebäudequalität und Ortslage (Auslegungsaußentemperaturen) zwischen -7°C und +2°C liegen. Der sog. Inverterpunkt sollte als Übergang zwischen modulierendem (bei min. Leistung der WP) und taktendem Betrieb bevorzugt über +7 bis +12°C liegen.
Zielführend ist hierbei weiterhin die Orientierung des Leistungsanteils der bivalent-parallel betriebenen Heizwärmepumpe an der Heizlast bei der Auslegungsaußentemperatur nach VDI 4645, um einen hohen Deckungsanteil am Jahresheizwärme-verbrauch zu erhalten.
Bei nicht vorliegenden Verbrauchswerten zur Heizlastermittlung (siehe oben: bevorzugt unterjährig (EAV) oder aus dreijährig dokumentierten MFH-Energieverbrauchsausweisen) wird als erster Schritt empfohlen, anstelle der Normheizlast nach DIN EN 12831 die Nettoheizlast und den Wärmeverlustkoeffizienten H aus einer möglichst realistischen Gebäude- und Anlagenbeschreibung mit dem EXCEL-Tool „Standardbilanz“ zu ermitteln und mit den oben geforderten Leistungskurven verschiedener Hersteller bei optimierten Bivalenz- und Inverterpunkten eine möglichst knapp dimensionierte Wärmepumpe auszuwählen.
Pufferspeicher und Hydraulik
Als Pufferspeicher sind für einfache nur Heizkörper- oder nur Fußbodenheizkreise bevorzugt Reihenpufferspeicher mit minimierten Speichervolumen (Optimierungskriterien: Begrenzung der WP-Takthäufigkeit oberhalb des Inverterpunkts – Speicherung der Abtauenergie) im Rücklauf des primären WP-Kreislaufs mit nur einer Pumpe und einem einstellbaren Überströmventil vorzusehen.
Bei Anlagen mit zwei oder mehreren getrennten Heizkreisen für Heizkörper und Fußbodenheizung (geschätzter Marktanteil: 10 – 15%) sind Parallelpufferspeicher mit mehreren Heizkreispumpen und Mischregelventilen notwendig. Der Vorteil niedriger Vorlauftemperaturen der Fußbodenheizkreise für die Wärmepumpeneffizienz kann bei Anlagen mit mehreren Heizkreisen meist nicht genutzt werden. In der Regel kann eine Temperaturschichtung in einem Parallelpufferspeicher wegen unterschiedlicher Primär- und Sekundärvolumenströme in der Praxis nicht eingehalten werden. Die Heizwärmepumpe muss deshalb für das höhere Heizkörpertemperaturniveau mit geringerer Effizienz betrieben werden.
Investitionskosten
Die aktuell von der Verbraucherzentrale erfassten mittleren Investitionskosten für Wärmepumpenheizanlagen sollten mit den hier beschriebenen Vorschlägen kurzfristig um mindestens 5000 bis 10000 € unterschritten werden.
Ob die staatliche Förderung von Wärmepumpen in gleichem Umfang wie in den zurückliegenden Jahren seit der Energiepreiskrise von 2022 weiterhin gegeben sein wird, ist zur Diskussion oder sogar in Frage zu stellen.
Begründungen im Gutachten für den Deutschen Bundestag (2020)
2020 haben wir in der „Corona-Zeit“ als Ergebnis eines Gutachtens für den Deutschen Bundestag den Nachweis führen können, dass der Einbau von Luft-Wasser-Wärmepumpen in Wohn- und Nichtwohngebäuden eine wirtschaftliche „No-Regret-Maßnahme“ darstellt; v.a. auch in Bestandgebäuden, gegenüber anderen Alternativen wie Holzpelletkessel oder einem Anschluss an Nah- oder Fernwärme.
Leider wurde das Gutachten erst im Sommer 2022 freigegeben – also mitten in der „Energiepreiskrise“ – und wenig bis gar nicht beachtet. Trotzdem halten wir die Ergebnisse des Gutachtens für hochaktuell.
Bereits 2007 – noch vor der Finanzkrise – wurde von Dr. Gerd Eisenbeiß, einem Berater der EU und von Bundeskanzlerin Angela Merkel -, der Vorschlag einheitlicher Kohlenstoffzertifikate als Zusammenführung für einen sektorenübergreifenden Emissionshandel gemacht; ähnlich wie dem für 2027 für die EU geplanten ETS II-Handel. Dieser fast zwanzig Jahre alte Vorschlag sollte aktuell wieder aufgegriffen werden.
Dies wurde 2020 im Gutachten für den Deutschen Bundestag mit der Annahme eines alle Sektoren übergreifenden CO2-Preis von durchschnittlich 400 €/Tonne CO2 bereits berücksichtigt und im dafür entwickelten Standardbilanz-Tool eingearbeitet.
Unter diesen Voraussetzungen wäre bereits bei aktuellen Energiepreisen für Gas und WP-Strom eine Wirtschaftlichkeit für den Einbau von Heizwärmepumpen auch ohne Förderung gegeben. Es gäbe dann auch keine Diskussionen mehr über die aktuell für den Bundes-Haushalt 2025/26 – 29 diskutierten unterschiedlichen Stromsteuern, Netzentgelten und weiteren Preisbestandteilen für unterschiedliche fossile Energieträger und für alle Sektoren. Die EU-weiten Zertifikate-Handel ETS I und ETS II könnten damit ab 2027 als Kohlenstoff-C-Zertifikate-Handel zusammengeführt werden. Weiterhin wäre damit eine einfache kontinuierliche Überprüfung des Klimaschutzgesetzes (2021) KSG gewährleistet.
